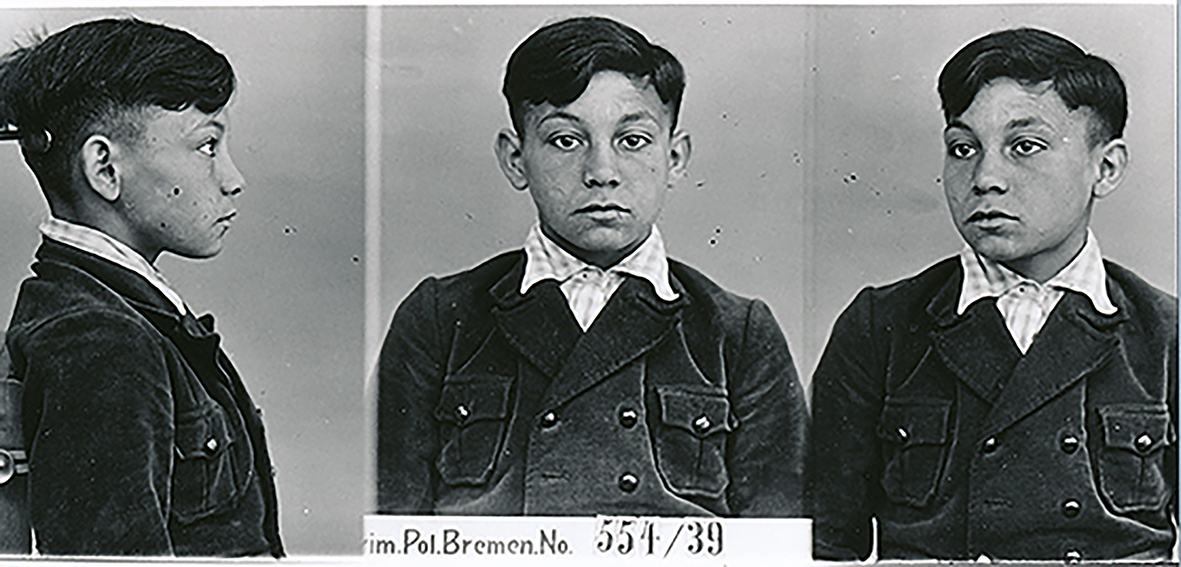Unter Befehl von Heinrich Himmler fand am 8. März 1943 in Bremen die Deportation von 269 Sinti und Roma statt. Begonnen hatten die Deportationen aber schon ab Mai 1940 in Arbeitslager in das sogenannte ‹Gouvernements Gebiet nach Polen. Heute findet deshalb im März jedes Jahr eine Gedenkveranstaltung statt, ein Kranz wird niedergelegt für die Verstorbenen und die 269 Namen werden verlesen.
rstorbenen und die 269 Namen werden verlesen. Die Erinnerungsarbeit, die jährlich am Schlachthof stattfindet, ist nicht nur Teil der Vergangenheitsbewältigung, sondern ist auch für die Gegenwart und die Gestaltung der Zukunft von großer Relevanz. Hermann Ernst betont die Bedeutung der Weitergabe dieser Geschichte an die junge Generation: ›Es ist auch wichtig, denke ich, dass die Kinder das hören, so wie wir es damals mitbekommen haben von unseren Eltern. Ich möchte, dass wir es so weitergeben.‹ Seine Mutter hatte ihm und seinen Geschwistern damals in der Küche beim Kartoffelschälen von ihrer Geschichte und ihren Erlebnissen erzählt. Mit sieben oder acht Jahren wurde sie früh morgens in Bremerhaven abgeholt und dann nach Belzec in ein Arbeitslager gebracht. Gegenstände der Erinnerung, Bilder oder Tagebücher gibt es nicht mehr, alles mussten sie in Bremerhaven lassen.
›Es ist auch wichtig, denke ich, dass die Kinder das hören, so wie wir es damals mitbekommen haben von unseren Eltern. Ich möchte, dass wir es so weitergeben.‹
Auch nach der Befreiung aus den Lagern blieb die Diskriminierung von Sinti und Roma – die Lebensbedingungen waren geprägt von Armutsverhältnissen, Liesbeth Ernst und weitere Überlebende kehrten zuerst in den Raum Hessen zurück, dann mit Ausblick auf eine Wiedergutmachung nach Bremen. Auf dem Wartburgplatz lebend, blieb die finanzielle Wiedergutmachung für viele aus, Liesbeth Ernst bekam sie erst nach zehn oder fünfzehn Jahren. Diese Erzählungen sind es, die Ernst nun an seine Kinder weitergibt, um die Aufklärung zu leisten, die etwa in Schulen nicht stattfindet.
Neben der Weitergabe an Familienmitglieder soll die Erinnerungsarbeit auch an die Öffentlichkeit, an Institutionen weitergetragen werden. ›Es sind so viele noch da, die unwissend sind‹, erklärt Ernst. Die Bildungsarbeit ist essenziell, um den kommenden Generationen ein Bewusstsein für die unsichtbare Geschichte der Sinti und Roma zu vermitteln. Marcus Reichert berichtet von der emotionalen Reaktion der Besucher:innen einer von ihnen organisierten Ausstellung, die in der Bremer Rathaushalle stattfand: ›Teilweise waren es ältere Leute, die weinend rausgerannt sind, die nichts davon wussten.‹
Diese Veranstaltungen und Initiativen, meist organisiert von Verbänden der Betroffenen, sollen das Verständnis und die Solidarität zwischen den Generationen und innerhalb der Gesellschaft fördern. Die Unterstützung von Freund:innen, Bekannten und weiteren Organisationen gibt dabei viel Kraft: ›Es ist ein Geben und ein Nehmen bei uns. Und ich bin so dankbar, dass wir hier auch den Arbeitskreis haben‹, sagt Ernst über die Zusammenarbeit bei regelmäßigen Treffen zum Planen von Vorträgen, Veranstaltungen und dem gemeinsamen Austausch.
Die Erinnerungsarbeit in Bremen zeigt, wie wichtig die Sichtbarmachung der Orte ist, an denen Sinti und Roma lebten, vertrieben wurden und wieder zurückkehrten. Durch Plätze der Erinnerung und deren klare Benennung werden die Lebensrealitäten der Sinti und Roma in das Jetzt geholt. Gegen das Verblassen der Geschichte und vor allem dafür, dass das wie Marcus Reichert sagt ‹nie, nie mehr vorkommen soll‹.